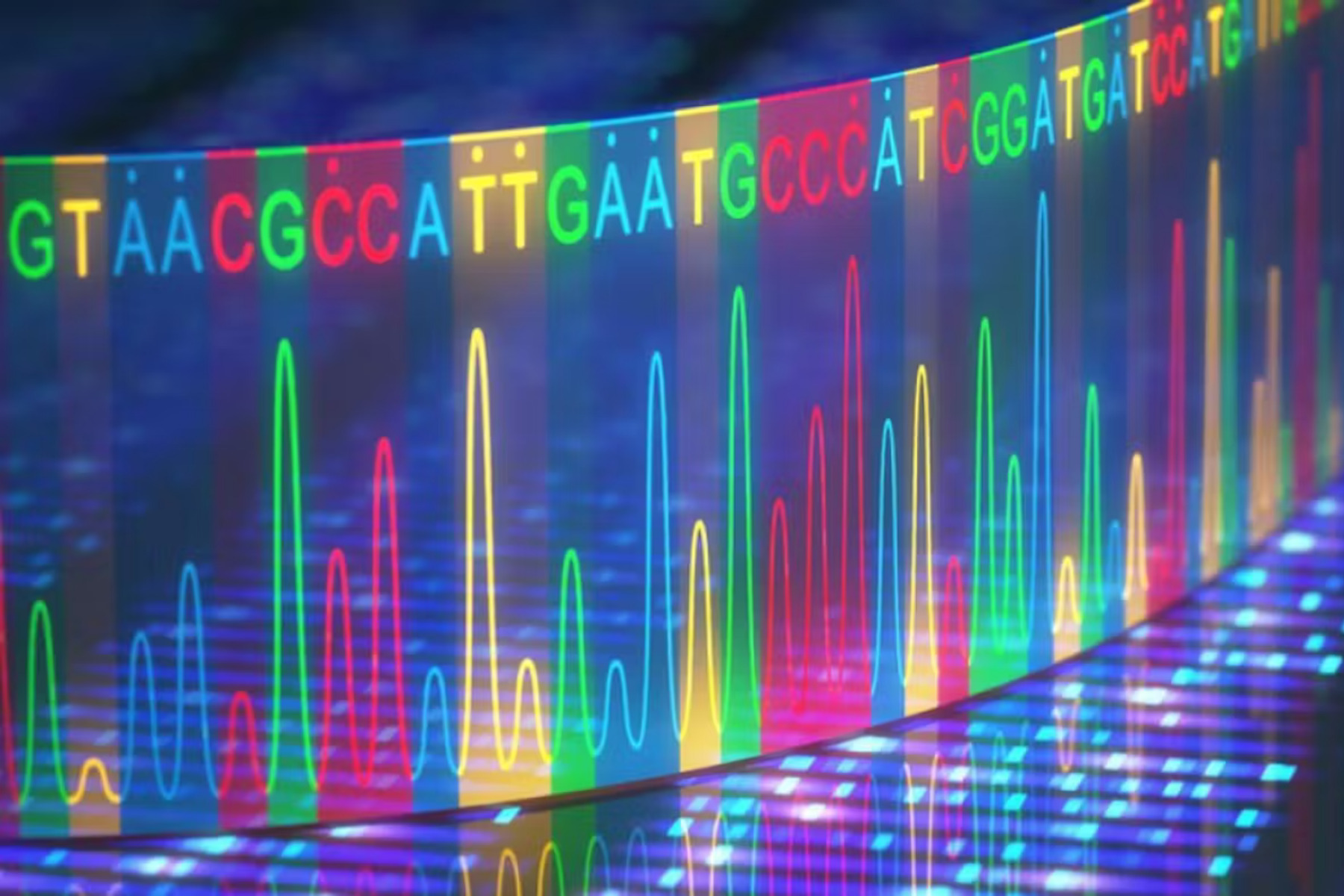Was ist Fragmentomik?
In den letzten Jahren haben Forscher erkannt, dass zirkulierende zellfreie DNA (cfDNA) im Blut weitaus mehr Informationen enthält als nur Mutationen. Die Fragmente der cfDNA spiegeln wider, wie das Chromatin während der Apoptose verpackt und geschnitten wird. Ihre Größe, ihre genomische Lage und die Endmotive bilden charakteristische „Fragmentierungsmuster“, die zusammen als Fragmentomik bezeichnet werden. Diese Muster bewahren die nukleosomale Struktur des Gewebes, aus dem sie freigesetzt wurden, und stellen damit eine Art epigenetischen Fingerabdruck dar. Besonders bedeutsam ist, dass Krebszellen ein verändertes Fragmentierungsmuster aufweisen, da Chromatinorganisation und Transkriptionsregulation in Tumoren verändert sind [1,2].
Die Möglichkeit, cfDNA-Fragmentierung nichtinvasiv zu untersuchen, eröffnet das Potenzial, Krebs früher zu erkennen, seinen Verlauf zu verfolgen und bestehende genomische Methoden zu ergänzen. Dieser Ansatz gehört zur Familie der Liquid Biopsies, die darauf abzielen, molekulare Informationen aus einer einfachen Blutprobe zu gewinnen.
MRD und ihre klinische Bedeutung
Die minimale Resterkrankung (Minimal Residual Disease, MRD) bezeichnet die geringe Anzahl an Krebszellen oder deren molekulare Spuren, die nach einer Therapie im Körper verbleiben. Obwohl sie bildgebend nicht sichtbar sind, können sie später einen Rückfall verursachen. Die MRD-Überwachung ist bereits in vielen hämatologischen Krebserkrankungen zum Standard geworden, und das Interesse an einer Anwendung bei soliden Tumoren nimmt stetig zu.
Studien zeigen, dass der Nachweis von zirkulierender Tumor-DNA (ctDNA) nach einer Operation ein zuverlässiger Prädiktor für ein Rezidiv ist. Bei Patienten mit kolorektalem Karzinom im Stadium II lag die Rückfallrate bei ctDNA-positiven Fällen bei über 80 % [3]; ähnliche Ergebnisse wurden auch bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs im Frühstadium berichtet [4]. Eine randomisierte Studie konnte zudem belegen, dass ctDNA-basierte Therapieentscheidungen den Einsatz von Chemotherapie im Stadium II sicher reduzieren können, ohne das Überleben zu verschlechtern [5].
Die klinische Relevanz ist hoch: Patienten, die tatsächlich krankheitsfrei sind, können vor belastenden Therapien bewahrt werden, während Patienten mit nachweisbarer MRD von einer intensiveren oder verlängerten Behandlung profitieren könnten.
Wie Fragmentomics die MRD-Detektion verbessert
Die meisten derzeitigen MRD-Tests verfolgen tumorspezifische Mutationen, die durch Sequenzierung des Tumorgewebes des Patienten identifiziert werden. Diese Tests sind zwar hochspezifisch, können jedoch an Sensitivität verlieren – insbesondere, wenn die ctDNA-Konzentrationen unmittelbar nach einer Operation extrem niedrig sind oder der Tumor nur wenige Mutationen aufweist. Zudem erfordern sie einen vorherigen Zugang zu Tumorgewebe, was nicht immer möglich ist.
Fragmentomics bietet hier einen tumor-unabhängigen, ausschließlich plasma-basierten Ansatz. Anstatt nach vordefinierten Mutationen zu suchen, werden globale Fragmentierungsmuster im gesamten Genom untersucht. Mithilfe von Machine-Learning-Modellen kann anschließend klassifiziert werden, ob ein cfDNA-Profil mit einer verbliebenen Tumorerkrankung übereinstimmt [6,7].
Dieser Ansatz hat bereits erhebliches Potenzial gezeigt. Beim nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom konnte durch die Kombination von Fragmentomics und dem Nachweis von Mutationen die Sensitivität zur Identifikation rückfallgefährdeter Patienten deutlich verbessert werden – von etwa 43 % mit Mutationen allein auf 78 %, wenn beide Signale kombiniert wurden [8]. Besonders wichtig: Die Methode erwies sich auch in sogenannten „low-shedding“-Tumoren als wirksam, in denen mutationenbasierte ctDNA kaum nachweisbar war.
Darüber hinaus lässt sich Fragmentomics mit weiteren epigenetischen Parametern, wie DNA-Methylierung, kombinieren, um die Genauigkeit der Detektion weiter zu steigern. Studien deuten darauf hin, dass multi-omische Testansätze langfristig sowohl eine hohe Sensitivität als auch eine hohe Spezifität erreichen könnten [9].
Warum Fragmentomics wichtig ist
- Frühere und sensitivere Warnsignale. Durch die Erfassung subtiler, genomweiter Muster erhöht Fragmentomics die Wahrscheinlichkeit, MRD auch dann zu identifizieren, wenn ctDNA-Konzentrationen unterhalb der Nachweisgrenze rein mutationsbasierter Tests liegen [8].
- Tumorunabhängige Skalierbarkeit. Da Fragmentomics keine Tumorsequenzierung erfordert, werden logistische Abläufe vereinfacht und Testzeiten verkürzt. Plasma-only-Workflows sind besonders in Versorgungssituationen von Vorteil, in denen der Zugang zu Gewebeproben eingeschränkt ist [6,7].
- Vielseitigkeit. Fragmentomics ist nicht nur für MRD von Bedeutung, sondern findet auch Anwendung in der Früherkennung von Krebs, in der Pränataldiagnostik, bei der Überwachung von Transplantatabstoßungen sowie in der Infektionsdiagnostik [3].
- Wegbereiter für die nächste Generation von MRD-Tests. Die Integration von Fragmentomics mit Mutations- und Methylierungsanalysen wird voraussichtlich die nächste Entwicklungsstufe der Liquid Biopsy definieren und so eine personalisierte Krebsmedizin sowie adaptive Behandlungsstrategien unterstützen [9].
Schlussfolgerung
Fragmentomics stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Interpretation der in cfDNA verborgenen Informationen dar. Indem nicht nur Mutationen, sondern auch die Art und Weise, wie DNA-Fragmente geschnitten und verteilt sind, betrachtet werden, liefert Fragmentomics ein ergänzendes und oftmals sensibleres Signal zur Detektion von minimaler Resterkrankung (MRD). Gerade bei Krebsarten wie Lungen- und Darmkrebs, bei denen das Rückfallrisiko auch nach kurativ intendierter Operation hoch bleibt, kann Fragmentomics frühere Warnhinweise und genauere Prognosen ermöglichen.
Das Forschungsfeld ist noch jung, doch die Richtung ist klar: Die Kombination von Fragmentationsmustern mit weiteren molekularen Merkmalen wird hochsensitive, tumorunabhängige und klinisch praktikable MRD-Tests ermöglichen. Diese Konvergenz aus Biologie, Sequenzierung und maschinellem Lernen könnte die Patientenüberwachung, die personalisierte Therapiegestaltung und letztlich die Verhinderung von Krebsrezidiven grundlegend verändern.
Literatur
- Snyder MW, Kircher M, Hill AJ, et al. Cell-free DNA Comprises an In Vivo Nucleosome Footprint that Informs Its Tissues-Of-Origin. Cell. 2016;164(1–2):57–68.
- Cristiano S, Leal A, Phallen J, et al. Genome-wide cell-free DNA fragmentation in patients with cancer. Nature. 2019;570(7761):385–389.
- Tie J, Wang Y, Tomasetti C, et al. Circulating tumor DNA analysis detects minimal residual disease and predicts recurrence in patients with stage II colon cancer. Sci Transl Med. 2016;8(346):346ra92.
- Abbosh C, Birkbak NJ, Wilson GA, et al. Phylogenetic ctDNA analysis depicts early-stage lung cancer evolution. Nature. 2017;545(7655):446–451.
- Tie J, Wang Y, Lo SN, et al. Circulating tumor DNA analysis guiding adjuvant therapy in stage II colon cancer: 5-year outcomes of the randomized DYNAMIC trial. Nat Med. 2025;31(5):1509–1518.
- Parikh AR, Van Seventer EE, Siravegna G, et al. Minimal Residual Disease Detection using a Plasma-only Circulating Tumor DNA Assay in Patients with Colorectal Cancer. Clin Cancer Res Off J Am Assoc Cancer Res. 2021;27(20):5586–5594.
- Chan HT, Nagayama S, Otaki M, et al. Tumor-informed or tumor-agnostic circulating tumor DNA as a biomarker for risk of recurrence in resected colorectal cancer patients. Front Oncol. 2022;12:1055968.
- Wang S, Xia Z, You J, et al. Enhanced Detection of Landmark Minimal Residual Disease in Lung Cancer Using Cell-free DNA Fragmentomics. Cancer Res Commun. 2023;3(5):933–942.
- Nguyen VTC, Nguyen TH, Doan NNT, et al. Multimodal analysis of methylomics and fragmentomics in plasma cell-free DNA for multi-cancer early detection and localization. Choi M, editor. eLife. 2023;12:RP89083.